Willkommen auf unserer Seite
| S. Allafi | ||||
| Frauen | Lyrische Seiten | Glaré Verlag |
* * *
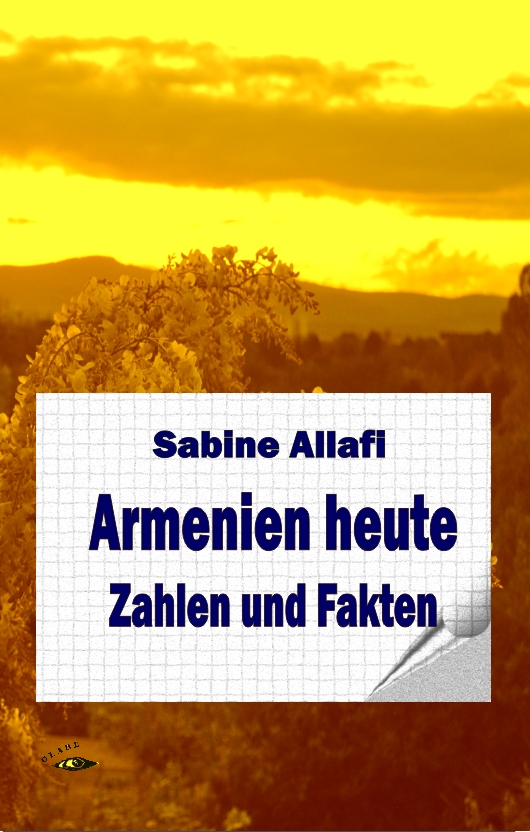
Sabine Allafi
Armenien heute - Zahlen
und Fakten
* * *
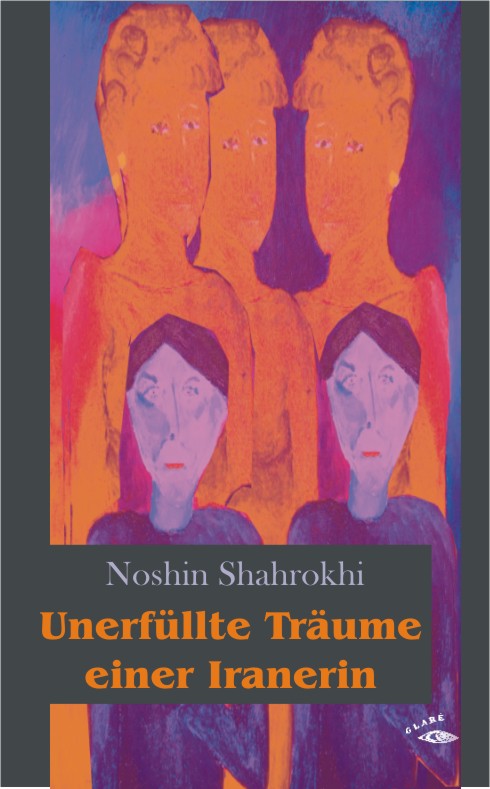
Noshin Shahrokhi
Unerfüllte Träume einer
Iranerin
* * *
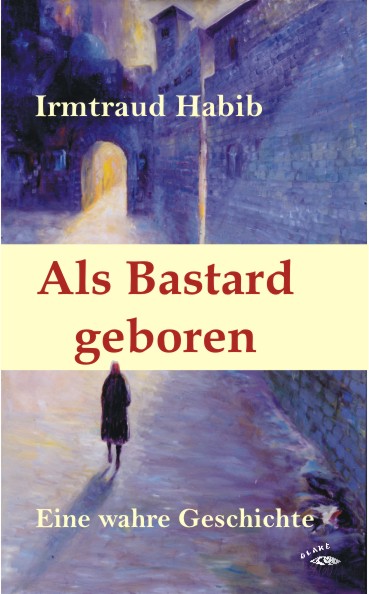
Irmtraud Habib
Als Bastard geboren
* * *
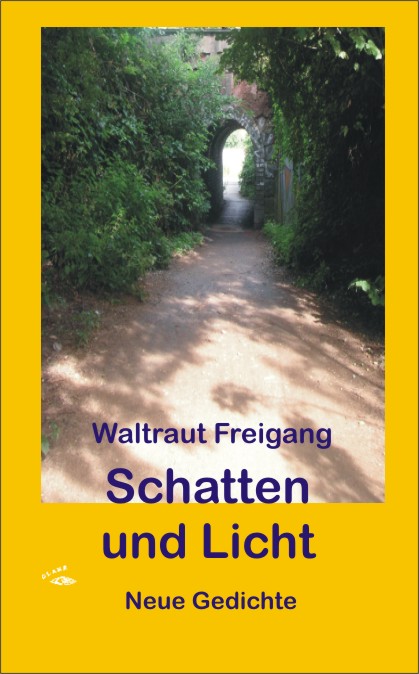
Waltraut Freigang
Schatten
und Licht
* * *
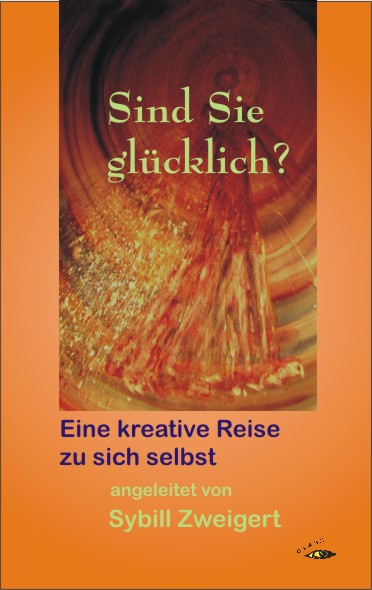
Sybill Zweigert
Sind Sie glücklich?
Wohin geht die türkische Gesellschaft? Kulturkampf in der Türkei
Rainer Hermann versucht in seinem Buch „Wohin geht die
türkische Gesellschaft? Kulturkampf in der Türkei“ ein umfassendes Bild von „der
türkischen Gesellschaft“ zu malen. In diesem Sinne beinhaltet es umfangreiche
Informationen aus verschiedenen Zeiten und Epochen. Doch ist die zentrale Frage
in der Türkei die Diskrepanz zwischen Staat und Gesellschaft. Diese Frage zieht
sich wie ein roter Faden durch alle Kapitel des Buches.
Das entscheidende Merkmal des Staates ist der kemalistische Nationalismus,
verknüpft mit einem durch die Kemalisten bestimmten Verständnis vom Islam. Der
Autor führt aus, wie der kemalistische Nationalismus von Anfang an dazu diente,
das Wesen der anderen großen Volksgruppen wie der Kurden, Armenier, Tscherkessen
und anderer zu leugnen. Zu diesem Zweck bedienen sich die Kemalisten einer
Palette staatlich festgelegter Möglichkeiten. Darüber hinaus wird, wenn sie zu
kurz kommen, das Militär tätig, das mittlerweile auf zahlreiche Putsche
zurückblicken kann, wobei es sich zugleich als Bestandteil bzw. Garant des
nationalistischen Staates versteht, bzw. ihm diese Rolle zugewiesen wurde. (So
fand alle 10 Jahre ein Putsch statt z.B. 1960, 1971 und 1980.) Das Militär ist
stets bereit, die Demokratie bzw. zivile Regierung außer Kraft zu setzen, wenn
das Türkentum in Gefahr scheint.
Neben dem Militär wird die Judikative instrumentalisiert, um der Gesellschaft
den Nationalismus aufzuzwingen, und wenn das nicht ausreicht, werden Kritiker
bzw. „Abweichler“ durch bestimmte Gruppen, die einen Draht zum Kemalismus und
Nationalismus haben, terrorisiert. Die Kemalisten instrumentalisieren auch den
sunnitischen Islam, um die religiösen Minderheiten wie Aleviten, Jeziden,
Christen und Juden als türkische Staatsbürger nicht zu akzeptieren. Hier wird
deutlich, dass die Kemalisten, die sich selbst gern als Laizisten bezeichnen,
ein anderes Verständnis vom Säkularismus haben, als es in den europäischen
Ländern der Fall ist. Zum Konzept des kemalistischen Staates gehören also weder
Freiheit noch Demokratie. Die kemalistische Staatsauffassung ist nichts anderes
als eine Herrschaftsform, die sich je nach dem auf eine Partei oder das Militär
stützt. Der Staat ist ein unantastbares Ganzheitsgebilde, das auf dem Türkentum
basiert und über allen anderen gesellschaftlichen Instanzen steht.
Der Autor zeigt die Unterdrückungsmechanismen dieses blinden Nationalismus
anhand zahlreicher Beispiele wie Putsche, Parteienverbote, Inhaftierung der
Kritiker, Massenmorde an Kurden, Armeniern … Straßenterror. Das Aufkommen der
islamistischen und islam-orientierten Bewegungen, Parteien und Persönlichkeiten
hält der Autor für glaubwürdige Indizien für den Übergang der Türkei zur
Demokratie, die gerade die Türkei für den Integrationsprozess in die EU
befähigt. Auch hat die Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Islamisten und
islam-orientierte Parteien der Türkei in den letzten Jahrzehnten wirtschaftliche
Erfolge und eine Ausweitung der geschäftlichen Beziehungen mit der EU und
insbesondere mit Deutschland beschert.
Das Aufkommen der neuen politischen Bewegung, die sich auf den Islam bezieht,
sieht der Autor im Kontext der Peripherie-Zentrum-Theorie. Das Zentrum ist
nichts anderes als eine kleine Gruppe von volksfernen urbanen Eliten, die immer
noch stur an dem kemalistischen Nationalismus festhalten. Obwohl sich diese
Eliten als westlich Orientierte über die Massen erheben, haben sie außer für
ihre eigene Bereicherung zu sorgen, nichts zur Integration der Türkei in Europa
beigetragen. Sie vergrößern, im Gegenteil, mit ihrem nationalistischen Getöse
die Distanz von Europa, da sie durch die Integration in Europa das Türkentum
gefährdet sehen. Diesen kleinen gescheiterten Eliten steht nun eine gewaltige
neue Elite gegenüber, deren Wurzeln in der Peripherie, nämlich in Anatolien,
liegen. Ausgerechnet diese Elite fordert mehr Freiheit und setzt auf die
Demokratisierung der Gesellschaft und Enttabuisierung der Existenz der großen
Volksgruppen wie zum Beispiel der Kurden. Bei den letzten Wahlen haben die
Türken mehr und mehr Zustimmung zur AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi; deutsch:
Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung) gezeigt, welche zurzeit diese neue
Elite repräsentiert. Nach Meinung des Autors ist diese Partei keine
islamistische Partei im Sinne ihrer Vorgängerin, sondern eher eine Partei, die
auf konservative Werte und Demokratie setzt, vergleichbar mit der CDU in
Deutschland.
Alles in allem ist die türkische Gesellschaft gekennzeichnet durch eine Vielfalt
vorhandener Probleme wie der Kurdenproblematik, der religiösen Minderheiten, der
Frauenfrage, der kulturellen und Meinungsfreiheit, die der Autor in
verschiedenen Kapiteln immer wieder thematisiert. Obwohl Hermann in der
Schilderung dieser Fragen sehr vorsichtig ist, zeigt sein Buch, dass die Türkei
vor einem Berg von politischen und kulturellen Problemen steht, während die
Gesellschaft weitgehend polarisiert ist. Eine Lösung dieser bestehenden Probleme
ist nur auf demokratischem Wege möglich, was die Islamisten bzw. die
islam-orientierten politischen Gruppen erkannt hätten. Das Buch ist in diesem
Sinne sehr informativ. Es ist zu empfehlen, wenn sich jemand nicht durch
ständige Zeitsprünge, wenig strukturierte Kapitel und Wiederholungen gestört
fühlt. Das Buch schien mir sehr schnell aus verschiedenen voneinander
unabhängigen Beiträgen zusammengestellt zu sein. Doch mich hat das nicht
gestört, meine Informationen über die Türkei wurden aufgefrischt.
M.H. Allafi
Rainer Hermann
Wohin geht die türkische Gesellschaft? Kulturkampf in der Türkei
dtv (September 2008)
ISBN: 978-3423246828
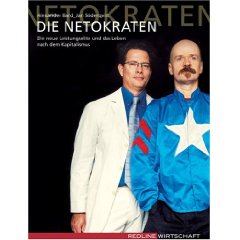 Das
Ende des Kapitalismus?
Das
Ende des Kapitalismus?
Das Buch „Die Netokraten“ von Alexander Bard und Jan
Söderqvist beinhaltet ein Bündel von interessanten und zugleich wilden
Grundgedanken, die die Autoren über den Entwicklungszustand der Weltgemeinschaft
mit Hauptblick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in der westlichen
Hemisphäre in einer nicht unbedingt strukturierten Form präsentieren. Der
Hauptgedanke ist, dass sich die bürgerliche Gesellschaft mit dem Aufkommen einer
neuen gesellschaftlichen Elite, den Netokraten, in einem Zerfallsprozess
befindet. Vereinfacht ausgedrückt: Die Netokraten sind heute dabei, die
Kapitalisten – die Eliten der bürgerlichen Gesellschaft – zu ersetzen, ohne sie
ganz aus der Gesellschaft zu verdrängen, wie auch die Kapitalisten seinerzeit
die Feudalherren nicht aus der Welt geschafft haben.
Die neue Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wird als Informationsgesellschaft
bezeichnet, in der den Netokraten die Massen – nicht des Proletariats, sondern –
des Konsumtariats gegenüber stehen. Der Übergang vom Kapitalismus zum
Informationalismus ist durch den Zerfall des Humanismus, der bürgerlichen Moral,
des bürgerlichen Bildungswesens und des bürgerlichen Staates, d.h. des
Nationalstaats, gekennzeichnet. Die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse unter
der Führung der Netokraten sind global ausgerichtet und sprachlich zunehmend an
der englischen Sprache orientiert. Das Hauptmerkmal der Netokratie ist die
Entstehung mannigfaltiger Netzwerke, die unabhängig von den bürgerlichen
Institutionen, sei es in juristischem Sinne, sei in politischem Sinne,
fungieren, denn die Netokratie hat ihre eigenen Regeln und Sanktionen. Somit
ersetzt die Netokratie die Demokratie. Die neu entstandenen Netzwerke sind
dabei, die bürgerlichen Massenmedien, welche als Propagandamaschinerie des
Kapitalismus betrachtet werden, überflüssig zu machen, während die politische
Klasse, die nichts anderes als die Puppen im Kasperletheater der
spätkapitalistischen Mediengesellschaft sind, in einer netokratischen
Gesellschaft durch sog. Kuratoren ersetzt werden. Diese Kuratoren sind die
mächtigste Gruppe der Netokratie, denn sie „weisen den Nexialisten den Weg,
während ihre gemeinsame Weltsicht von den Philosophen der netokratischen
Gesellschaft, den analytischen Eternalisten, entworfen wird.“ (S. 118) Im
Vergleich mit dem Kapitalismus sind die Nexialisten die Entrepreneure, die
Eternalisten sind die Akademiker. Die Massen des Konsumtariats als
Benachteiligte in der neuen Gesellschaft, die aus lauter vereinzelten und
isolierten Konsumenten bestehen, werden sich nicht wie das Proletariat in der
kapitalistischen Gesellschaft wehren können, dennoch werden sie sich wehren
müssen, denn zwischen diesen Hauptgruppen entsteht ein Interessenkonflikt, der
zur Reiberei führt. Welche Art Kämpfe stattfinden wird, wer sich mit wem gegen
wen verbündet, das lassen die Autoren offen. Auch bleiben die Ziele der neuen
Eliten völlig offen, die nach Meinung der Autoren nicht wie die Kapitalisten
unbedingt an der Profitmaximierung interessiert sind. Welche Ziele nun die
Netokraten verfolgen und warum sie sie verfolgen, wird leider nicht
konkretisiert. Doch zeigt das Buch die Konturen einer Veränderung, die durch das
Aufkommen des Informationalismus geprägt ist. Es ist auch nicht klar, wie weit
die Akteure einer netokratischen Gesellschaft die anderen Bereiche des
menschlichen Gemeinwesens wie die Nahrungsmittelindustrie, das Gesundheitswesen
etc. beeinflussen werden und warum sie diese überhaupt beeinflussen wollen.
Vielleicht auch zum Zweck der Gewinne und Profite? Sind die Netokraten doch die
künftigen Kapitalisten? Oder sind die Kapitalisten die künftigen Netokraten?
Oder haben es die Menschen in der Zukunft mit einem netokratischen Kapitalismus
zu tun?
Alles in allem ist dieses Buch für Leute, die sich Gedanken über die jetzige und
zukünftige Welt machen, absolut zu empfehlen, denn die Autoren bringen eine
Reihe von neuen Gedanken und Beobachtungen ein, die allemal bezüglich der
Erklärung der Welt stimulierend sind, somit bietet das Buch auch eine Basis für
die Erklärung und das Verstehen der weltweiten neuen Entwicklungen.
M.H. Allafi
Alexander Bard_Jan Söderqvist: Die Netokraten
Redline Wirtschaft, Heidelberg 2006
ISBN 978-3-636-013279
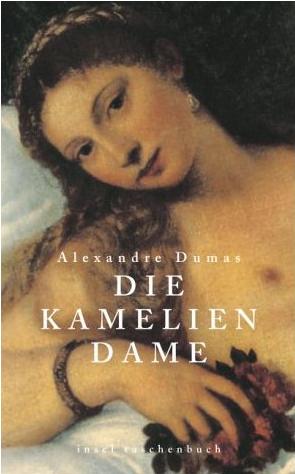 Alexandre
Dumas beschreibt in diesem Buch nicht nur im Zeitalter der aufkommenden bürgerlichen
Gesellschaft die Liebe, sondern er charakterisiert die Menschen grundsätzlich.
Es geht um
Menschen, denen wir in seiner Zeit wie vor tausend Jahren wie auch heute
begegnen - ungeachtet der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse, der moralischen
Kodexe bleibt der Mensch eben Mensch mit vielen Fassaden, die mal
erschreckend, mal schön und mal romantisch, mal schlicht und mal hinterhältig ... wirken.
Wenn man die Sprache und den Erzählstil durch den Kopf gehen lässt und relativ
zur heutigen literarischen Sprache einen Vergleich zieht, wird man traurig,
denn man sieht, wie wenig die Autorinnen und Autoren unserer Zeit in diesem
Sinn auf Lager haben.
M.H. Allafi
Alexandre
Dumas beschreibt in diesem Buch nicht nur im Zeitalter der aufkommenden bürgerlichen
Gesellschaft die Liebe, sondern er charakterisiert die Menschen grundsätzlich.
Es geht um
Menschen, denen wir in seiner Zeit wie vor tausend Jahren wie auch heute
begegnen - ungeachtet der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse, der moralischen
Kodexe bleibt der Mensch eben Mensch mit vielen Fassaden, die mal
erschreckend, mal schön und mal romantisch, mal schlicht und mal hinterhältig ... wirken.
Wenn man die Sprache und den Erzählstil durch den Kopf gehen lässt und relativ
zur heutigen literarischen Sprache einen Vergleich zieht, wird man traurig,
denn man sieht, wie wenig die Autorinnen und Autoren unserer Zeit in diesem
Sinn auf Lager haben.
M.H. Allafi
Alexandre Dumas: Die Kameliendame
Insel Taschenbuch, Frankfurt 2004
ISBN 978-34583-4710-1
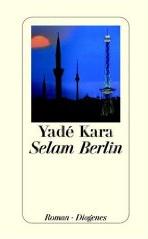 Berlin in der Zeit des Mauerfalls. Die
Eltern des in Kreuzberg direkt an der Mauer aufgewachsenen jungen Türken Hasan
Kazan haben
sich getrennt. Er verlässt die Mutter, die wieder in Istanbul lebt, und zieht
beim Vater in Kreuzberg ein und wieder aus. Er träumt von einer Karriere beim
Film und begegnet nur Kleingeistern, während seine Familie von der
Wiedervereinigung stärker betroffen ist, als ihm lieb ist. Ein schönes Zeitbild
vom Anfang der 90er, der Versuch mit so einigen Vorurteilen aufzuräumen, und
unterhaltsame ist das Ganze auch noch.
Sabine Allafi
Berlin in der Zeit des Mauerfalls. Die
Eltern des in Kreuzberg direkt an der Mauer aufgewachsenen jungen Türken Hasan
Kazan haben
sich getrennt. Er verlässt die Mutter, die wieder in Istanbul lebt, und zieht
beim Vater in Kreuzberg ein und wieder aus. Er träumt von einer Karriere beim
Film und begegnet nur Kleingeistern, während seine Familie von der
Wiedervereinigung stärker betroffen ist, als ihm lieb ist. Ein schönes Zeitbild
vom Anfang der 90er, der Versuch mit so einigen Vorurteilen aufzuräumen, und
unterhaltsame ist das Ganze auch noch.
Sabine Allafi
Yadé Kara: Selam Berlin
Diogenes Verlag, Schweiz 2003
ISBN 978-32570-6335-6
Mit dem Glück ist das so eine Sache - und mit der Liebe
ebenfalls. Das wissen wir, seit Frauen angefangen haben, Romane zu schreiben.
Ein modernes Beispiel liefert die israelische Autorin Yael Hedaya in ihrem 2006
auf deutsch erschienenen Roman unter dem Titel Die Sache mit dem Glück
(Originaltitel: Mati).
Ein braver Roman über zwei Frauen, die einen Mann lieben, der dabei ist,
aufgrund seiner Krebserkrankung die Welt zu verlassen. Das führt ihn zwar nicht
mit seiner wahren Liebe zusammen, denn die bringt es nicht über sich, die Tür zu
seinem Kranken-/ Sterbezimmer zu öffnen, wohl aber seine Ehefrau mit der
freakigen, deutlich jüngeren Ex-Geliebten, die ihn seinerzeit verlassen hat. Ein
geschickt komponierter, auch frecher Roman mit erschreckend sachlicher
Beschreibung des Verlaufs einer Krebserkrankung. Dynamik erhält er auch aus dem
ständigen Perspektivenwechsel, der beiden Frauen, nicht aber des Kranken, und
auch der Ärzte, von denen die Angehörigen mit der Ausweglosigkeit seiner
Situation konfrontiert werden.
Sabine Allafi
Yael Hedaya: Die Sache mit dem Glück
Diogenes Verlag, Schweiz 2006
ISBN 978-3257065473
© M.
und S. Allafi
Zuletzt geändert:
05/05/16
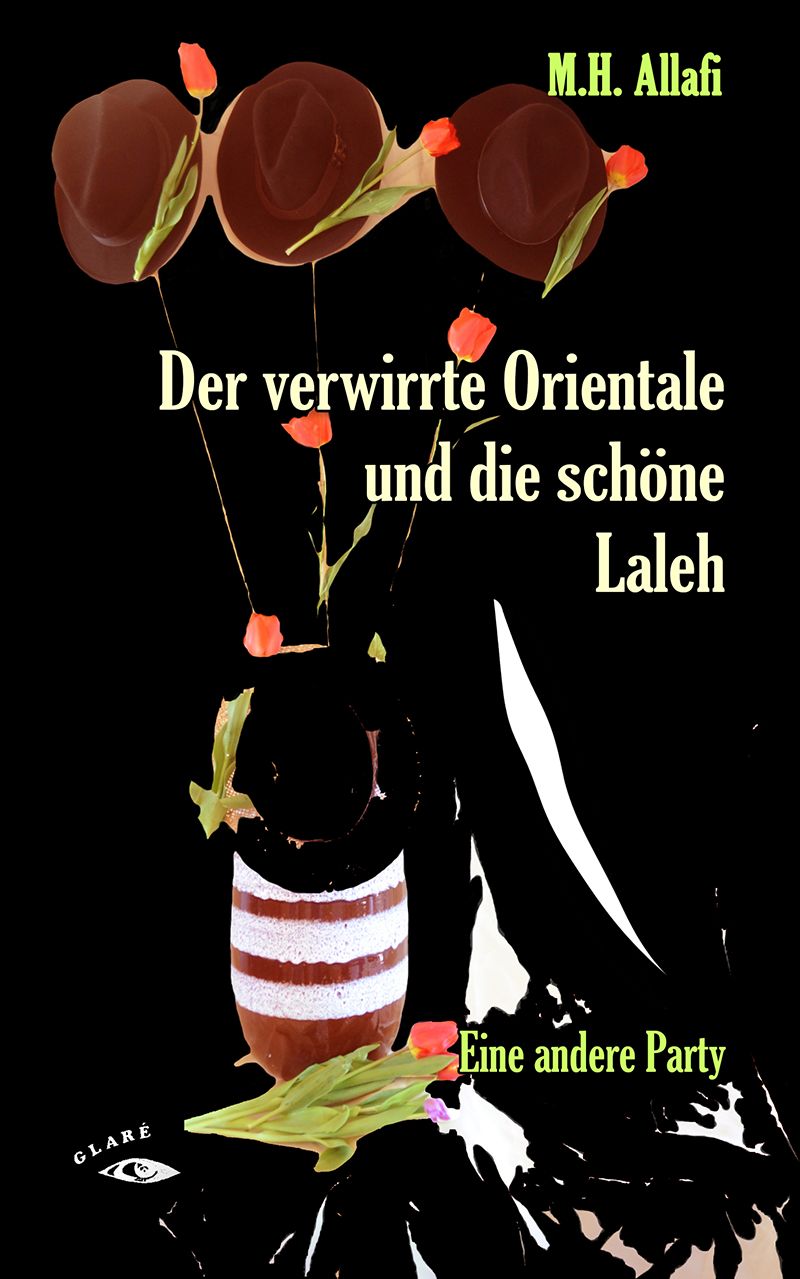
M.H. Allafi
Der verwirrte Orientale und die schöne Laleh
* * *

M.H. Allafi
Gabriela
findet einen
Stapel Papier
* * *
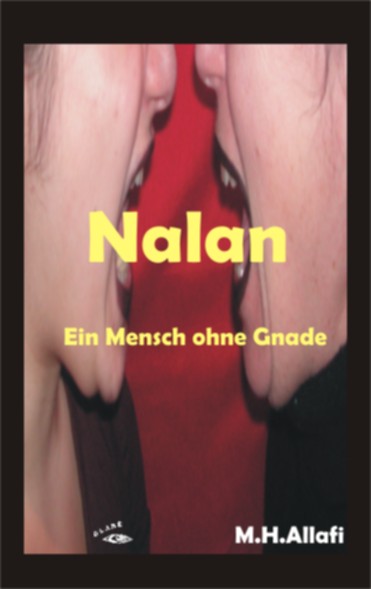
M.H. Allafi
Nalan -
Ein Mensch
ohne Gnade
* * *
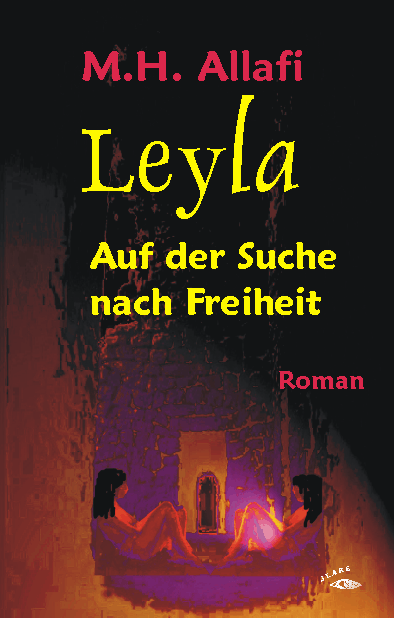
M.H. Allafi
Leyla -
Auf der
Suche nach Freiheit
* * *
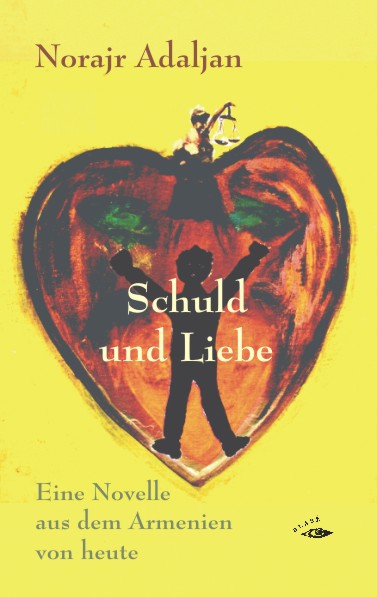
Norajr Adaljan
Schuld und Liebe
* * *
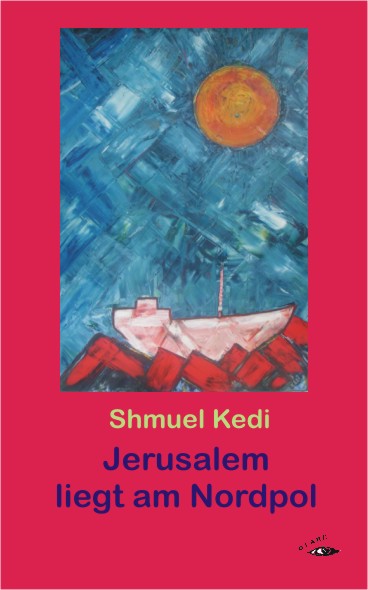
Shmuel Kedi
Jerusalem
liegt am Nordpol
* * *
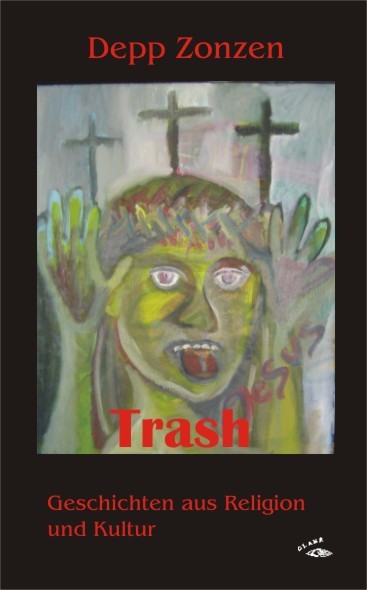
Depp Zonzen
Trash